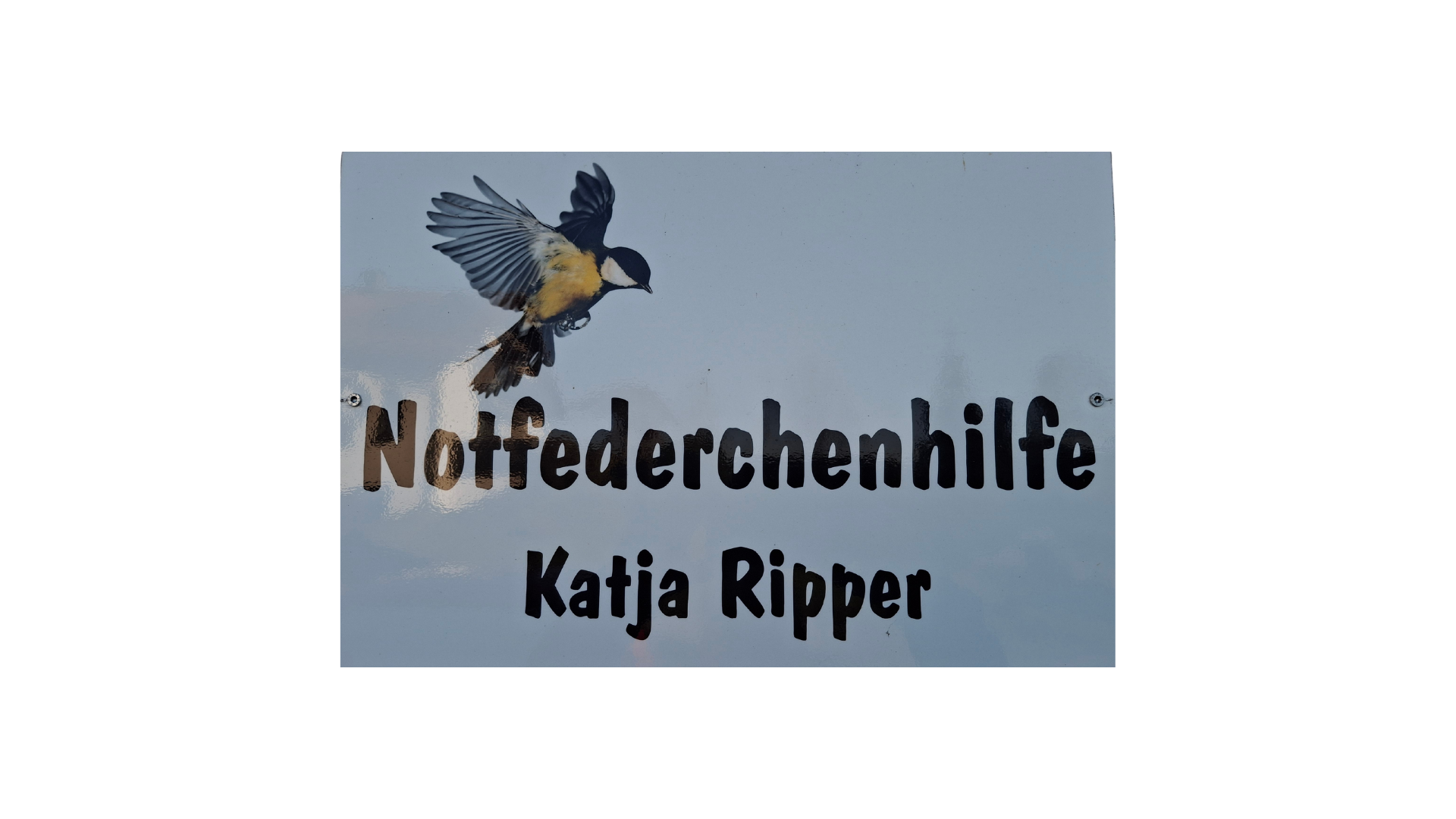Rote Liste – Historie & Erstellungsprozess
Die Rote Liste dient bis heute zur Information der Öffentlichkeit über gefährdete, verschollene und ausgestorbene Pflanzen, Tierarten, Biotope, wie auch Landschaften. Sie ist keine rechtliche Grundlage für Verstöße oder der Gleichen, kann aber als Entscheidungshilfe bezüglich bedrohter Arten für Übereinkommen, Richtlinien, Verordnungen und Gesetze zum Naturschutz herangezogen werden.
Historie
1971 wurde die Rote Liste mit Gefährdungssituation für Vogelarten und 1977 die erste Rote Liste für gefährdete Tiere und Pflanzen erstellt.
1984 erfolgte durch die Weiterentwicklung die Neubearbeitung und Erweiterung der Roten Liste für Säugetiere von 170 Fachleuten.
Seit 1993 ist der Bund für Naturschutz (BfN) durch seine Gründung Herausgeber der Roten Liste und berücksichtigt hier mehr als 60 Organismengruppen der Tier-, Pflanzen- und Pilzwelt. Die Aktualisierung erfolgt in der Regel alle zehn Jahre durch die Beratung einer Vielzahl von Experten und Vereine mit dem Bund für Naturschutz.
1994 wurde durch ein bundesweites Symposium, der Beschluss gefasst, dass alle Roten Listen sämtlicher Bundesländer eine Gesamtartenliste enthalten und ein Kriteriensystem für alle Artengruppen gleichermaßen verwendet wird. So wird die Rote Liste und einzelne Kriterieneinschätzungen nachvollziehbarer und transparenter. Nachdem 1998 die nächste Fassung der Rote Liste auf Grundlage des Beschlusses von 1994 erstellt wurde, wird eine Aktualisierung nun für alle zehn Jahre angestrebt.
Die einheitliche Methodik findet seit 2006 ihre Anwendung; die letzten Einzelbände der Roten Liste wurden 2009 veröffentlicht:
- Band 1 Wirbeltiere
- Band 2 Meeresorganismen
- Band 3 Wirbellose Tiere
- …
- Band 6 Pilze (Flechten und Myxomyzeten)
Im März 2024 fand die Autorentagung zur Roten Liste bezüglich der aquatischen Ökosysteme statt. Diese wurde durch die Rote-Liste-Autorenschaft, das Rote-Liste-Zentrum, sowie dem Bund für Naturschutz geführt.
Erstellungsprozess
Für die Erstellung der Roten Liste wird die, wie 2006 verabschiedete, einheitliche Methodik angewendet und Datenmengen zunächst aus kleineren Räumen wie Landkreise, später dann vom jeweiligen Bundesland bis hin zur gesamten Bundesrepublik herangezogen.
- Taxonomische Checkliste: Für in Deutschland lebende Arten, sowie Unterarten (einheimischer, aber auch nach Deutschland verschleppter – sogenannte “Neobiota”). Die Gefährdungseinschätzung gilt für Neobiota nur eventuell. Für unbeständige und noch nicht etablierte Arten, ist eine gesonderte Kennzeichnung anzuwenden.
- Datensammlung: Sind Bestandsdaten in früheren Fassungen vorhanden, werden für die Datensuche und -aquise, die der letzten Aktualisierung herangezogen. Relevante Daten kommen unter anderem von:
- Naturschutzbehörden der Länder
- regionale Kartierungsprojekte
- Naturkundemuseen
- Fachgesellschaften
- etc.
- Gefährdungsanalyse: Eine Abbildung der Informationen entsprechend Bestandssituationen und -trends zu den einheimischen Arten durch Experten. Die ersten drei Kriterien dieser Analyse werden anhand Informationen und Schätzungen in Skalen mit verschiedenen Schutzklassen eingeordnet. Seit 1994 haben diese IUCN-Kategorien in Deutschland ihre Gültigkeit, wodurch anhand des Einstufungsschemas die Rote Liste ermittelt wird.
- Bei der aktuellen Bestandssituation wird der Umfang der in Deutschland etablierten Populationen geschätzt und jede Art in eine Bestandsklasse eingestuft: sehr häufig, häufig, mäßig häufig, mäßig, selten, sehr selten, extrem selten, ausgestorben, verschollen. Je nach Datenlage werden die Beobachtungen der letzten zehn bis fünfzehn Jahre betrachtet und die indirekte Ableitung bei einer schwierigen Datenlage verwendet.
- Für den langfristigen Trend wird die Entwicklung der vergangenen 50 bis 150 Jahre in einer Skala von Trendklassen einsortiert: sehr starker Rückgang, starker Rückgang, mäßiger Rückgang, Rückgang im Ausmaß unbekannt, stabil, deutliche Zunahme, Daten ungenügend.
- Durch persönliche Beurteilungen von Experten wird der kurzfristige Trend mit seinen Veränderungen der vergangenen 10 bis 25 Jahre in Trendklassen wie der des “langfristigen Trends” eingestuft.
- Bezüglich Risiko und stabile Teilbestände wird eine Vorhersage bezüglich der Verschlechterung des kurzfristigen Bestandstrends für die kommenden zehn Jahre (z.B. bisher stabil zu mäßige Abnahme) und eine Abschätzung der Gefährdung für die absehbare Zeit zum Aussterben stabiler Teilbestände gemacht.
Beim Konzept der Verantwortlichkeit trägt das Bundesland, bzw. der Mitgliedsstaat die Verantwortlichkeit für den Fortbestand der Tiere die nur dort vorkommen, obwohl sie weltweit gesehen werden.
Gefährdungskategorien der Roten Liste Arten
Seit 1994 haben unten aufgeführte Beispiele der IUCN-Kategorien in Deutschland für Arten ihre Gültigkeit.
Aktuelle Bestandssituation:
| ex | ausgestorben |
| ew | in freier Wildbahn ausgestorben |
| cr | vom Aussterben bedroht |
langfristiger Bestandstrend:
| < | mäßiger Rückgang |
| (<) | Rückgang (Ausmaß unbekannt) |
| = | stabil |
kurzfristiger Bestandstrend:
| ↓ | Mäßiger Rückgang |
| (↓) | Rückgang (Ausmaß unbekannt) |
| = | Stabil |
Risiko / stabile Teilbestände:
| = | Nicht festgestellt / Nicht Relevant |
| – | Risikofaktor(en) ist/sind vorhanden und wirksam |
| + | Es existieren stabile Teilbestände bei ansonsten vom Aussterben bedrohten Taxa |
Rote-Liste-Kategorien (RL):
| 0 | Ausgestorben oder verschollen |
| 3 | Gefährdet |
| V | Vorwarnliste |
| * | Ungefährdet |
Verantwortlichkeit Deutschlands (V):
| ! | In hohem Maß verantwortlich |
| : | Allgemeine Verantwortlichkeit |
| nb | nicht bewertet |
Benennung einzelner Risikofaktoren (Risiko):
| D | Verstärkte direkte Einwirkungen |
| F | Fragmentierung / Isolation |
| I | Verstärkte indirekte Einwirkungen |
Grund der Kategorieänderung:
| R | Reale Veränderungen der Gefährdungssituation |
| K | Kenntnisszuwachs |
Quelle:
https://www.rote-liste-zentrum.de/de/Historie-1794.html
https://www.rote-liste-zentrum.de/files/Publikation_RL%20Saeugetiere_%202020_barrierefrei.pdf
https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/rote-liste/57605
https://www.rote-liste-zentrum.de/de/Gesetzliche-Schutzmassnahmen-1848.html
https://www.bussgeldkatalog.org/umwelt-naturschutz
https://www.rote-liste-zentrum.de/de/Erstellung-und-Methodik-1710.html
https://www.rote-liste-zentrum.de/de/Jetzt-anmelden-zur-Rote-Liste-Autorentagung-2024-2138.html
Dieser Artikel hat seinen Ursprung bei Jenny Köhler